Kommentar
kontertext: Zeitungsabo erneuern? Eine Art Abrechnung
Jährlich steht der Entscheid an, das Abonnement der Tageszeitung zu erneuern. So war es jedenfalls, als man noch ein «Leibblatt» hatte. Die Kadenzen sind inzwischen viel kürzer geworden, manche Leserinnen und Leser entscheiden alle paar Monate, je nach Marktlage und Sonderangebot, und der Entscheid wird immer schwieriger. Vielleicht entspricht das dem üblichen gesellschaftlichen Trend, vielleicht lockern sich ja die Bindungen an ein «Leibblatt» ebenso wie die Treue zu Parteien, Musikstilen, Mobilfunkanbietern oder Krankenkassen. Die Zeitungslandschaft ist in Krise – und die Leserschaft auch.
Abonnement verlängern oder Anbieter wechseln? Der Entscheid, der von kulturellen Vorlieben und politischen Haltungen beeinflusst wird, ist schwieriger geworden, weil sich die Lage auf dem Zeitungsmarkt durch die politischen Verschiebungen der letzten zwei Jahrzehnte stark verändert hat (man denke an die Querelen um die BaZ und die aggressive Umorientierung der NZZ). Tausende sind auf steter Wanderschaft: von der BaZ zur bz, von der bz zum Tagesanzeiger, ins Internet, zur NZZ. Und wieder zurück?
Der Entscheid hat aber durchaus auch eine pekuniäre Seite. Mit der Konkurrenz der Gratiszeitungen und der Vielfalt der digitalen Gratisangebote hat sich die ökonomische Krise der Tageszeitungen ständig verschärft und übt wegen dem Schwund der Auflagenzahlen und Werbeeinnahmen einen starken finanziellen Druck auf die Redaktionen aus, die nach Einsparmöglichkeiten suchen müssen. Auch die Leserschaft betrachtet die Situation prosaischer, fast betriebswirtschaftlich nüchtern. Mit der Lockerung des Treueverhältnisses sind die Zeitungsleserinnen und -leser einfach Marktteilnehmer geworden. Die Frage lautet schnöde: Ist mir das Abo die geforderten 524 oder 574 oder 779 Franken wert? Wie viel Journalismus, gar «Qualitätsjournalismus», bekomme ich eigentlich für mein Geld? Diese Frage habe ich in in der 50. Kalenderwoche (9.–14.12.2019) an drei deutschschweizerischen Tageszeitungen überprüft, der bz von der CH-Mediagruppe, dem Tagesanzeiger (TA) und der NZZ, wobei mein «Nutzerinteresse» leitend war, also das Bedürfnis, mir mit Hilfe der Tageszeitung ein vielseitiges Bild der Geschehnisse in der Welt zu machen.
Journalismus oder Werbung?
Rechnen wir also. Mit einem bz–Jahresabo kostet eine Seite etwa 4,2 Rappen, beim Tagesanzeiger 3,6 Rappen, bei der NZZ 5,4 Rappen (am Kiosk je etwas mehr als das Doppelte). Das Nutzerinteresse fragt nach: Bekomme ich für dieses Geld wirklich journalistische Qualitätsware? Natürlich nicht, man erhält auch eine Menge Werbung, Halbwerbung und Pseudojournalismus.
Über die Testwoche gerechnet ist etwa ein Fünftel der Zeitungen mit Inseraten belegt, diese können aber auch ein Drittel ausfüllen (wie beim Tagesanzeiger vom 14.12.2019). Werbung ist für Verlage überlebenswichtig, für das Nutzerinteresse aber kein Journalismus. Kommt dazu, dass die Grenzen zwischen Werbung und redaktionellem Teil fliessender sind, als es der publizistische Grundsatz, Anzeigen müssten klar abgegrenzt sein, zuliesse. Neuerdings muss man sich einen Kontrollblick auf die Ressortzeile angewöhnen, um sicherzugehen, dass die Seite, die man zu lesen beginnt, nicht als «sponsored» markiert ist, wie im Tagesanzeiger vom 11.12.2019, wo uns «Genève Invest» ganzseitig und im unverwechselbaren Tagi-Look das Ende der Anlegerwelt auf das Jahr 2023 prophezeit. Dabei ist in den publizistischen Leitlinien des TA festgehalten: «Anzeigen dürfen durch ihre Gestaltung nicht den Eindruck erwecken, sie seien redaktioneller Bestandteil des Mediums. Insbesondere ist auf eine klare Unterscheidbarkeit der Typographie zu achten.» Das ist im Eifer des Tagesgeschäfts vergessen gegangen.
Und steckt im Porträt des Kleinwagens Citigo (TA 10.12.19), im Bericht über die Rallye Monte Carlo am Steuer des Mini 1967 (TA 12.12.2019) oder in der Anpreisung des VW Golf 8 TSI 1,5 (bz 14.12.2019) nicht auch eine tüchtige Portion Werbung? Oder in der Empfehlung des «Capitol Kempinski Hotels Singapur» (TA 13.12.2019)? Wie steht es mit den Tipps für den Ausgang, wenn beispielsweise ein Maurice Müller darüber informiert, in welcher Bar, welchem Restaurant, welchem Club er mit welchen Genussmitteln den «perfekten Abend» für total nur 63.50 Franken verbringt (TA 9.12.2019)? Und die doppelseitige Jubiläumsgabe zu 175 Jahren Luxushotel «Baur au Lac» (NZZ 9.12.2019), die man gut in eine goldgeränderte Firmenschrift übernehmen könnte? Auch täglich eine oder zwei Seiten Radio- und TV-Programm oder vier dicht bedruckte Seiten Finanz- und Anlagezahlen (NZZ) bieten nicht besonders viel Qualitätsjournalismus. Profis rufen solche Daten doch längst zeitaktuell im Internet ab.
Beim Nutzerinteresse hat man also, approximativ, 25–30 Prozent an Nutzwert abzuziehen.
Wenn Zeitungsverlage sparen müssen, können sie die Preise erhöhen oder die Honorare senken. Beides haben sie in den letzten Jahren spürbar getan. Die Redaktionen können aber auch mehr günstige Textformate einlayouten, um Kosten zu senken. Was heisst das? Die Herstellung einer Seite Zeitung kann unterschiedlich teuer sein. Am teuersten zu stehen kommen investigative Recherchen, sie erfordern intensive Datenanalysen, Nachfragen bei vielen Beteiligten, Erkundungen vor Ort, Gegenproben und Gegenlesen. Das ist bei komplexen Themen (Stichwort «Panama Papers») nur noch in Verbünden zu schaffen. Günstiger ist es, Agenturmeldungen und Artikel aus anderen Medien zusammenzufassen, was oft praktiziert wird, wie man beim Scrollen durch die digitalen Angebote der internationalen Presse leicht feststellen kann. Noch günstiger sind Kommentare zu einem Thema (vor allem wenn man den Bericht dazu selber geschrieben hat) oder reine Meinungsäusserungen. Noch günstiger: Impressionen und Glossen, etwa über die vorweihnächtliche Stimmung in der Zürcher Bahnhofstrasse oder über Menschen und Paare in einem Fitnesscenter. Solche Texte kann man mit wenig Aufwand von der Leber weg produzieren. Noch billiger sind wohl Fotos, vor allem wenn sie aus einem Agenturabonnement abgerufen werden können.
Billige Formate
Die Sparmethode, mit einem fetten Anteil billigerer Formate den Preis zu senken, wurde in der Testwoche unter die Lupe genommen. Ein medienwissenschaftliches Institut müsste einmal genau nachrechnen, wie sehr in den letzten Jahren dieser Anteil zugenommen hat. Mein Eindruck ist jedenfalls: allüberall mehr Meinungen, mehr Standpunkte, Kommentare und Glossen, mehr Scheindebatten (‹Was macht denn Greta heute?›), mehr rezykliertes Material, viel Material mit schnellem Ablaufdatum, fast schon Makulatur. Und viel mehr grosse Bilder.
Der Tagesanzeiger schockiert gleich am Montagmorgen (9.12.2019) auf Seite eins mit Boris Johnson in Grossaufnahme. Boris füllt fast die Hälfte des Satzspiegels aus und streckt die Hand aus, als wolle er nach mir greifen. Er wird mich dann die ganze Woche über verfolgen, vor allem im TA, der ihn fast täglich vorführt auf insgesamt 2400 cm2, also volle zwei Seiten nur Boris, Boris in der Speditionsfirma (‹einer, der liefert›), Boris unter begeisterten Tory-Wählerinnen (‹wie exzentrisch!›), Boris mit Hündchen (‹so nett!›). Da kommt Corbyn mit mickrigen 112 cm2 wirklich schlecht weg, viel schlechter jedenfalls als Regula Rytz, die es im TA in der Testwoche zusammengerechnet immerhin auf fast eine Seite bringt.
Selbstverständlich ist eine moderne Tageszeitung ohne Bilder undenkbar, eine Bleiwüste kann man der Kundschaft nicht zumuten. Aber zu oft sind Bilder einfach günstiger Ersatz für Inhalte. Warum muss, was in der bz und dem TA oft vorkommt, das Bild der Person, die im Zentrum eines Artikels steht, so viel Platz einnehmen wie der Text selbst? Und was erfahren wir, wenn in einem Bericht über Kryptowährungen eine Ansicht der Stadt Zug mitgeliefert wird – nur weil Zug eben ein «Kryptovalley» ist? Auch die vielen übergrossen Symbolbilder, die aus Verlegenheit und zum Auffüllen verwendet werden, liefern meist keine Zusatzerkenntnis. So wird im TA vom 9.12.2019 ein Artikel über das Ansteigen des Durchschnittsalters mit einer stark vergrösserten Augenpartie eines älteren Menschen garniert, weil wir eben ernsthaft dem hohen Alter «ins Auge blicken» müssen.
Wir rechnen: Die bz, die generell eher ein luftiges Layout pflegt, geht mit ihrer Bebilderung in der Samstagsausgabe bis auf 25 Prozent (14.12.2019), sie tapeziert die Seiten überhaupt gerne mit so viel Bild, dass nicht selten mehr als die Hälfte des Satzspiegels damit belegt ist. Der TA bebildert etwa ein Sechstel der Fläche, die NZZ ist mit ungefähr einem Achtel dezenter ausgestattet, sie setzt auch weniger auf die Riesenformate. Seiten ohne Bilder sind in allen drei Zeitungen eine Rarität.
Fazit: Weniger Bilder und dafür eine oder zwei Seiten mehr gehaltvolle Texte würden die Zeitungen überhaupt nicht in eine Bleiwüste verwandeln. Das Nutzerinteresse hat also eine weitere Wertminderung von, sagen wir, 5 Prozent einzurechnen.
Meinung – wohlfeil, aber keineswegs gratis
Vor Jahrzehnten lief jeweils am Samstagmittag eine von Hans Gmür moderierte Radiosendung «Mini Meinig – Dini Meinung» mit dem Songrefrain «Ich ha mini Meinig, du hesch dini Meinig, und genau so sölls au sii.» An diesen Refrain erinnere ich mich häufig, wenn ich in den Tageszeitungen die Meinungs- und Debattenseiten aufschlage, die sich meinem Empfinden nach in den letzten Jahren wundersam vermehrt haben. Die Meinungswelle in den Tageszeitungen ist ein – zugegeben: gedämpftes – Echo der in den sozialen Medien tosenden Meinungslawinen. Die NZZ bringt täglich drei bis vier Seiten (also etwa 10 Prozent der Ausgabe), der TA und die bz zwei, und dazu noch eine Glosse da, eine Ratgeberei dort. Hinzu kommt zudem, dass die Grenze zwischen Bericht und Kommentar seit längerem verschwimmt und sich Meinungen und Gestimmtheiten immer mehr in den Sachberichten breit machen.
Mein Nutzerinteresse braucht eigentlich keine Meinungsbeiträge. Auch keine, die meine eigene Meinung bestätigen, denn die kenne ich ja schon. Auch Hansueli Schöchlis Meinung zur geplanten Sonderrente für Ausgesteuerte (NZZ 10.12.2019) brauche ich nicht, denn die kenne ich auch schon im voraus, ebenso wie Michael Raschs Sorge, dass ein mögliches Engagement der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen den Klimawandel zu Planwirtschaft führen könnte (NZZ 13.12.2019). Solche Wertungen sind in den Voreinstellungen der betreffenden Journalisten ja bereits festgelegt, einen Lerneffekt haben sie nicht.
Meinungen und Kommentare sind heute wohlfeil zu haben. Zwar finden sich durchaus gehaltvolle Debattenbeiträge, wie etwa Christian Weisflogs Einblick in die Demokratiebewegung im Libanon (NZZ 13.12.12), daneben aber auch viel Durchschnittsware und eine Menge Banales, wie die Suche nach dem perfekten Kundengeschenk für Weihnachten (bz 14.12.2019) oder Philipp Zweifels Probleme mit dem PC-Drucker (TA 14.12.2019). Und nicht selten geht es mehr um Meinungsmache als um Meinungsbildung, zum Beispiel im Artikel «Achtung, Faschismus!» (NZZ 14.12.2019) von René Zeyer, der unter diesem Titel nicht etwa vor den Gefahren wiederauflebender faschistischer Tendenzen warnt, sondern vor jenen Journalistinnen und Journalisten, die den Faschismusbegriff auf aktuelle politische Strömungen anwenden. Zeyer möchte das Wort am liebsten aus der politischen Debatte weghaben, weil es ja bloss ein vager «politischer Kampfbegriff» sei. Kann es sein, dass Zeyer nichts davon erfahren hat, wie diesen Herbst in Italien die Salvinisten und die mit ihnen verbandelten Fratelli d’Italia gegen die Auschwitzüberlebende Liliana Segre eine antisemitische Hetzkampagne inszenierten, mit wüsten Beschimpfungen und Drohungen, so dass sich seitdem die betagte Dame nur noch mit Personenschutz durch Mailand bewegen kann? Davon konnte man doch im «Spiegel» oder in der «Süddeutschen Zeitung» lesen, und die «Repubblica» hat den Fall breit dokumentiert. Auch von den politischen Morden rechtsextremer Täter in Deutschland scheint Zeyer noch nie gehört zu haben, jedenfalls verliert er in seinem Beitrag kein Wort über solche Phänomene. Erstaunlich! Ganz weltblind versenkt er sich in seine Polemik.
Auch das Nutzerinteresse ist erstaunt, dass es für solche Meinungsmache bezahlen muss. Es möchte aber nicht und budgetiert für alles Banale und Propagandistische einen Abzug von mindestens 5 Prozent.
Dreimal dasselbe
Sparpotential zu Lasten des Nutzerinteresses bietet die Mehrfachverwertung von Texten oder Textbausteinen, vor allem im Vorfeld wichtiger Ereignisse, wenn regelmässig berichtet und spekuliert werden kann. Wie sehr diese Sparmethode die Zeitungen prägt, merkt man in der Regel nach den Ferien, wenn zu Hause ein Papierberg auf einen wartet und man sich beim Sichten der letzten 12 Portionen Tageszeitung seitenweise durch immer wieder aktualisierte Beiträge über einen bevorstehenden Gipfel mit Trump und Kim Jong-un blättert im Wissen, dass dabei ja wieder nichts herausgeschaut hat – ausser einer Menge Altpapier. In der Testwoche waren es die Wahlen in England und die Bundesratswahl in der Schweiz, welche mit immer wieder ähnlichen Verweisen und Spekulationen und über 30 Beiträgen in den drei beobachteten Tageszeitungen die Spalten füllten.
Eine Mehrfachverwertung lässt sich leicht auch in ein- und derselben Ausgabe praktizieren, als Dreifachverwertung von Anriss, Hauptartikel und Kommentar. Auf diesem Gebiet ist der Tagesanzeiger unbestritten Meister. Ausnahmslos alle Beiträge auf der ersten Seite sind kurze oder längere Anrisse und verweisen auf einen Hauptbericht und eventuell einen Kommentar. Man verpasst aber nichts, wenn man die Anrisse nicht liest, denn alles Wichtige ist im Hauptartikel enthalten. Eine zusätzliche Gelegenheit zur Repetition liefern die Kommentare, die meist einige Argumente oder Fakten des Berichts wieder aufnehmen und mit einer Wertung versehen. Aber nur in Ausnahmefällen gewinnt man aus dem Kommentar zusätzliche Hinweise, die einen schlauer machen und die Wertung fundieren.
Man könnte die erste Seite des TA also ohne Verlust glatt weglassen, auch bei der bz trifft dies zu. Auch manchen Kommentar könnte man streichen, etwa jenen auf Seite eins in der bz vom 10.12.2019, deren Quintessenz im umwerfenden Schlusssatz steckt: «Es bleibt die schon fatalistische Erkenntnis, dass sich bei vielen Problemen an der Spitze des Sorgenbarometers – seien es Altersvorsorge, Klimawandel oder eben Wohnungsnot – so schnell nichts ändern wird.» Mit diesem Leertext war offensichtlich im Stress des Tagesgeschäfts noch eine Lücke von 24×6 cm zu füllen. Einzig die NZZ verfährt in dieser Hinsicht redlicher: Anrisse sind seltener, jede Ausgabe bietet auf der ersten Seite einen oder mehrere in sich geschlossene Artikel. Vielleicht hat die NZZ eine Leserschaft, die weniger auf Repetitionen angewiesen ist.
Blaupausen-Texte
Offenbar hat sie aber auch eine Leserschaft, die ein journalistisches Genre eifrig nachfragt, das sich seit Jahren in den Feuilletons (aber nicht nur dort) eingenistet und ausgebreitet hat wie ein Trojaner: der Anti-Gutmensch-Text. Mit verblüffendem Wiederholungszwang wird bis in die Provinzblätter hinab tüchtig gegen die political correctness, gegen den Tugendterror, die Menschenrechtsideologen, die Verbotsunkultur etc. gehalten. Das Eigenartige an diesem Genre, das in der Regel ein Vorkommnis wie die Störung eines Vortrags oder das Aufkommen des Gender-Sternchens zum Anlass nimmt, um dann generell gegen die Besserwisserei der politisch Korrekten Einspruch einzulegen, besteht darin, dass immer das gleiche Muster repetiert wird und am Ende die Schreibenden alles noch besser wissen als die Besserwisser. Es sind immer die andern, die Gutmenschen aller Couleur, die sich in ihren Echokammern und Meinungsblasen selbst einframen, nie die Verfasserinnen und Verfasser selbst, obwohl ihre Haltung doch längst die neue political correctness vorgibt, zumindest in vielen Zeitungen.
In der Berichtwoche setzt sich der Geschlechterforscher Vojin Saša Vukadinović in der NZZ vom 12.12.2019 auf einer ganzen Seite (genauer: auf einer halben, die andere Hälfte wird von einem Symbolbild eingenommen, das eine Kopftuch tragende Frau an einem Strand zeigt) mit dem Kulturrelativismus einer Gender-Theorie auseinander, die sich zwar progressiv gebe, in Wirklichkeit aber reaktionär und frauenfeindlich sei, weil sie unter dem Vorwand kultureller Toleranz Unterdrückung an Frauen toleriere. Das tönt bedenkenswert, und der Artikel setzt denn auch mit toxischen Zitaten bekannter Gender-Forscherinnen ein. Etwa: «Warum ist das Arrangieren einer haltbaren Ehe frauenfeindlich und die Wegwerfscheidungen prominenter Männer, die periodisch ein älteres gegen ein jüngeres Modell austauschen, nicht?» Vukadinović hat noch härtere Zitate auf Lager, aber es lässt sich nie feststellen, welcher von den genannten Forscherinnen sie zuzuordnen sind und in welchem Zusammenhang sie stehen. Man ist als Leser auf diesem Gebiet ja nicht so firm, dass man aus dem Kopf diese Zusammenhänge gleich selber herstellen könnte, und wäre auf Klärung angewiesen. Der Autor begibt sich aber mit keinem Satz in das verminte Spannungsfeld, das sich zwischen kulturellem Respekt und Kampf gegen Unterdrückung auftut, er legt auch mit keinem Wort dar, wie man in diesem schwierigen Gelände einen gangbaren Pfad finden könnte.
Misstrauisch hat mich Vukadinovićs Methode gemacht, die unterschiedlichsten Formen von Frauenfeindlichkeit, vom Kopftuchzwang über die Zwangsehe für Kinder bis zu Gruppenvergewaltigung und Genitalverstümmelung, einfach zusammenzuwerfen und so quasi ununterscheidbar zu machen. Dadurch bekommt er eine scharfe Waffe in die Hand, die er gegen Leute, die sich nicht klar für ein Kopftuchverbot aussprechen, richten kann, obgleich er selbst im Übrigen nie deutlich macht, ob er denn für ein generelles Verbot des Kopftuchtragens eintrete und wie er es allenfalls durchsetzen würde. Er zitiert dafür Christina von Braun und Bettina Mathes mit der Aussage «Auch wir möchten kein Kopftuch tragen. Aber» –, die mit ihrem «Aber» gleich unter Verdacht geraten, noch viel Schlimmeres zu tolerieren als Kopftücher, auf jeden Fall aber, sich misogyn und rassistisch zu äussern. Eigentlich geht es Vukadinović, aber wer hätte das nicht geahnt, am Ende doch wieder bloss um eine Abrechnung mit dem «Zeitgeist» und seiner «moralische Emphase, es gut zu meinen und noch besser zu wissen». Mit diesem Normsatz gegen die Gutmenschen ist die Katze aus dem Sack – und man ist so gescheit als wie zuvor. Lieb ist bös und gut ist schlecht, progressiv ist reaktionär und links ist rechts. Der ganze Aufwand dieser Luftgitarrennummer war für nichts und wieder nichts – allenfalls gut für einige Takte Diffamierung.
Von ein und derselben Blaupause, wie sie Vukadinović verwendet, sind in den letzten Jahren unzählige Kopien gezogen worden, mit wechselnden Themen und unterschiedlichen Zielgruppen: Klimajugend, Antifaschisten, Marktkritiker, Egalitäre etc. Die NZZ ist zu einer Art Fachblatt für solche Anti-Gutmensch-Texte geworden, hier wird man wöchentlich gleich mehrmals der ständigen Wiederholung des Gleichen ausgesetzt. Aber auch andere Zeitungen führen sie im Angebot. Für das Nutzerinteresse ist das Ärgerliche an diesem Genre, dass einfach immer wieder das gleiche Grundmuster kopiert wird, dass es sich im Grunde genommen immer um denselben Text handelt. Welch enorme Verschwendung von Lesezeit und Platz!
Das Nutzerinteresse rechnet ab. Es hat sich inzwischen ja eine recht lange Liste aufgetan. Reklame und versteckte Werbung sowie ein beträchtlicher Anteil günstiger Formate mit wenig Gehalt vermindern den Nutzwert der geprüften Tageszeitungen. Aufgeblasene Bildteile, Kommentare und Meinungen als Leergut oder Meinungsmache, Mehrfachverwertung von Texten und Nullnummerjournalismus reduzieren die Zahl der Artikel, die den Leserinnen und Lesern tatsächlich helfen, sich ein vielseitiges Bild von der Welt zu machen. Machen wir es kurz und banal und rechnen über den Daumen gepeilt: 50-60 Prozent der Zeitungsfläche sind für all dies zu veranschlagen, wodurch sich der Preis für das journalistische Gut mehr als verdoppelt – und dabei ist nicht berücksichtigt, dass wegen mangelndem Interesse zahlreiche Texte ohnehin der Lektüre entgehen, denn nicht jede Leserin interessiert sich für Modefragen, nicht jeder Leser für Formel-1-Berichte. All dies berücksichtigend, hat man sich jede Zeitung sehr viel dünner vorzustellen, als sie sich anfühlt.
Die Frage der Abonnementserneuerung bleibt weiter offen. Leider ist der Schweizer Markt zu klein für Blätter wie die «Süddeutsche» oder den «Guardian». Gäbe es sie, fiele die Entscheidung leichter.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Christoph Wegmann, geboren 1948, lebt in Basel. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie und unterrichtete an Gymnasien und in der Erwachsenenbildung. Er schreibt Rezensionen, Essays und Gedichte für Ausstellungskataloge und Anthologien. Im Mai 2019 erschien im Berliner Quintus Verlag die Bildstudie «Der Bilderfex. Im imaginären Museum Theodor Fontanes». Hier für 83.90 CHF und dort für 60 Euro plus Portokosten aus Deutschland (nach Deutschland portofrei).
- Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe Autorinnen und Autoren über Medien und Politik. Sie greift Beiträge aus Medien auf und widerspricht aus politischen, journalistischen, inhaltlichen oder sprachlichen Gründen. Zur Gruppe gehören u.a. Bernhard Bonjour, Rudolf Bussmann (Redaktion, Koordination), Silvia Henke, Mathias Knauer, Guy Krneta, Alfred Schlienger, Felix Schneider, Linda Stibler, Martina Süess, Ariane Tanner, Rudolf Walther, Christoph Wegmann, Matthias Zehnder.


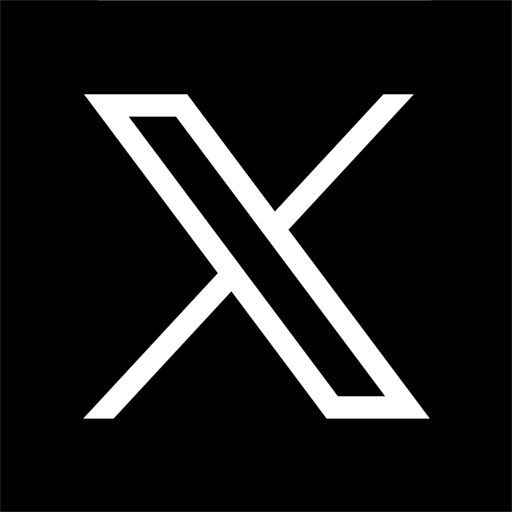









Vielen Dank, Herr Wegmann. Bin schon am Ende der momentanen Entwicklung angekommen: Keine Tageszeitung mehr, keine Zeitung von TA-Media mehr, keine NZZ mehr und schon ziemlich lange: keine WW mehr. Dabei hatte ich zeitweilig sogar sehr viele Jahre 2 Zeitungsabonnements (inkl. Zeitung am Sonntag) und(!) eine Wochenzeitung. – Heute ist es nur noch die WOZ und IS, die ich abonniert habe und sonstwie unterstütze. Mehr als 30 Jahre lang war ich treuer Zeitungsleser, doch was heute geboten wird, ist das Papier oft nicht wert, auf dem es steht.
Sie haben hier alles beschrieben, was mich vertrieben hat. Und es sieht leider aus, als sei das endgültig. Ich mag Suppino nicht und nicht für was er steht, ich mag Jordot nicht und schon gar nicht Guyer. Ich mag Ringier nicht und den Blick-CR noch weniger. Ich mag auch all die überheblichen Kommentare nicht in den Zeitungen, diese Meinungsmache, diese Manipulation der Leser, diese Auslassungen (Nichtberichten über wichtige Themen).
Und vor allem mag ich nicht, wenn ich beim Lesen das Gefühl bekomme, als unmündig, als unwissend, als zu belehrend betrachtet werde.
Der Verfasser empfiehlt indirekt die «Süddeutsche Zeitung», die viele in Deutschland auch «Süddeutscher Beobachter» nennen. Das Blatt ist aus meiner Sicht ein gutmenschliches Indoktrinationsblatt der Extraklasse: Stets für die EU-Instanzen, stets für die grenzenlose Einwanderung, stets für die Zahlung Deutschlands an alle «Handaufhalter» rundum, stets für die Eurorettung durch groteske Maßnahmen und so weiter und so fort. Ich habe leise Zweifel, ob die Befolgung der gutmenschlich-täglichen SZ-Ratschläge durch die schweizer Politik zu Lasten das Landes viel Freude in der Eidgenossenschaft stiften würde.
Sorgfältig recherchiert, analytisch und hilfreich. Dazu humorvoll und ohne unnötige Seitenhiebe. Ein Lesevergnügen!
Dank solchen Texten halte ich mich gerne an den Infosperber.
Wir leben bald im Jahr 2020 und es ist leider immer noch nicht möglich, sich seine Zeitung selber zusammen zu stellen.
Wie schön wäre es, die regionalen Nachrichten regional zu abonnieren, den Wirtschaftsteil bei der NZZ und FAZ, Inland beim Tagi, Ausland bei der SZ, Sport beim SRF, Wissenschaft bei… etc.
Universalzeitungen sind heute weder finanzierbar, noch marktgerecht.
Und ja, der Kampagnenjournalismus hat leider stark zugenommen und verscheucht die echten, zahlungsbereiten Zeitungsleser. Oder: wenn die Russischen Radarbilder gefälscht, da aus Russland und die Radarbilder der NATO echt, da von der NATO; dann ist es Zeit, das Abo zu kündigenn. Nicht weil Russland Fan, sondern wegen zu viel Hirnzellen für zuwenig Journalismus.
Vielen Dank Herr Wegmann. Wie wahr, ein schönes Weihnachtsgeschenk….:) . Eine Entscheidung hat der Leser zu fällen, keine vorgefasste Meinung, somit mein Problem, DANKE. Nun, z.B. WW seit W.Wollenberger’s-Zeiten nicht mehr gelesen/gekauft und vorgestern NZZ nach 48 Jahren abbestellt. The Guardian ist Lesepflicht, dies ab 1964. Werde wohl zusammen mit dem absterbenden Blätterwald alt.
Vorschlag: Der Autor liest nur noch Infosperber. Dann muss er sich nie mehr ärgern, weiss sowieso alles besser und kann sich und uns derart selbstgerechte, oberflächliche Bandwurmuntersuchungen ersparen.
Guter Artikel.
Mit dem Tagi habe ich quasi (Zeitung) Lesen gelernt. NZZ und BaZ habe ich auch jahrelang konsumiert; alle 3 hatte ich schon mal abonniert. Heute geht mein «Medien-Batzen» nicht mehr in die Medien-Konzerne, stattdessen spende ich regelmässig an diverse, kleine, unabhängige News-Kanäle, der Infosperber ist einer davon.
Wegmanns Argumente würden mir schon genügen ein Abo nicht mehr zu erneuern.
Was mich am meisten stört an den Leitmedien: Sie sind zur «Lückenpresse» degeneriert. Der Ausdruck stammt von Ulrich Teusch, der ein Buch mit selbigem Titel geschrieben hat. Man kann leicht erraten, was damit
gemeint ist.
Kommt dazu: Gerade die Etablierten veröffentlichen regelmässig «Fake News», um nicht zu sagen Lügen.
Siehe z.B. «Julian Assange: Das Russland-Komplott war Fake-News» (von Urs P. Gasche hier im IS).
Last but not least ist mir die Dämonisierung politischer Figuren wie Putin, Kim, Xi, Erdogan, Orban, Maduro, Duterte etc. pp völlig zuwider, wenn man bedenkt, wie dieselben Blätter andere Führer wie z.B. die Al-Sauds oder Netanyahu quasi mit Samthandschuhen behandeln.
Die Kombination aus gezielten «Lücken» und «Fake News» ergibt je nach Thema ein sehr «gefiltertes Bild».
Ich empfinde dies als bewusste Irreführung, zwar nicht auf staatlicher Ebene, aber Propaganda durch Konzerne ist ebenso effektiv.
Die grosse Mehrheit der Leitmedien ist für mich in vielen Themen völlig unglaubwürdig geworden.
Nachdem ich seit Jahren schon keinerlei Zeitungs- oder Zeitschriften-Abonnements mehr unterhalte, habe ich zum neuen Jahr die nächste Stufe gezündet und mich von den Online-Ausgaben der Tages- und Wochenzeitungen zurückgezogen. Hauptgrund: ich hatte zunehmend den Eindruck, im Austausch für meine Aufmerksamkeit keinerlei Nutzen mehr zu bekommen. Wohin man auch schaut: reine Meinungsmache – zuweilen sehr subtig (!), vorgefertigte Weltbilder, Pseudodiskussionen und Pseudoinformationen. Irgendwie ziemlich überflüssig und so überhaupt gar nicht meine Vorstellung von gutem Journalismus, der vor allem beschreiben sollte, was ist.
Viele Blogs habe ich gleich mit auf den Müllhaufen geworden – verbunden mit der Hoffnung, dass die guten Vorsätze nachhaltig sein werden. Positive Nebeneffekte haben sich schon eingestellt: mehr verfügbare Zeit und mehr Platz im Kopf für eigene Gedanken.