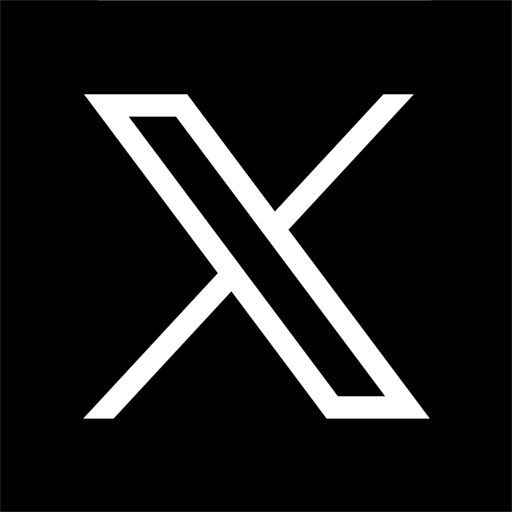Sprachlupe: Gilt es ernst, muss ein Ruck durchs Land
«Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen!» So verdichtete Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Montag die Ausrufung der «ausserordentlichen Lage» wegen des Coronavirus. Die Forderung nach einem Ruck durchs Land ist sprichwörtlich geworden, seit sie der deutsche Bundespräsident Roman Herzog 1997 erhob, schon damals mit fernöstlichem Anstoss, wenn auch ganz anderer Art: «Ich komme gerade aus Asien zurück. In vielen Ländern dort herrscht eine unglaubliche Dynamik.» Dagegen sehe er im eigenen Land «ganz überwiegend Mutlosigkeit», ergo: «Durch Deutschland muss ein Ruck gehen».
Zuvor waren, so weit das Internet zurückreicht, Rucke vor allem durch Sportmannschaften gegangen. Aus der deutschen Politik ist immerhin schon von 1988 überliefert, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Hessen so einen Ruck wahrnahm: Der sei nach einem Wahlsieg seiner CDU durch dieses Bundesland gegangen. Aber es dauerte noch ein Jahrzehnt, bis der Ruck in aller Munde war. Dann jedoch auch rückblickend: Ein Buch erinnerte 2014 an einen Fitness-Ruck von 1975, beflügelt durch die Teilnahme des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel an einem Volkslauf.
Ruckwärtsgewandt
Auch die Schweiz wurde zum Land des Rucks, jedenfalls im Geschichtsbild, das Bundesrat Ueli Maurer 2011 in einer Rede vorlegte: «Dank dem Ruck, der damals durch das Volk ging, blieb die Schweiz ein unabhängiges, freies Land – auch in der schwierigen Zeit der 30er-Jahre und des Zweiten Weltkrieges. Wenn ich landauf, landab mit den Leuten spreche, habe ich den Eindruck, dass heute ein ähnlicher Ruck durch unser Land geht: Die Schweizer wollen unabhängig bleiben.» Der Vergleich rückte, ob mit oder ohne Absicht, die europäische Einigung als Gefahr in eine Parallele zum Nationalsozialismus.
Sommarugas Ruf nach einem Ruck kommt ohne historische Vergleiche aus; es geht auch nicht um eine politische Aufwallung im engeren Sinn. Es geht vielmehr darum, dass sich alle persönlich einen Ruck geben – den Ruck, die Gefahr des Virus für die Gesellschaft so ernst zu nehmen, dass man sein eigenes Verhalten danach richtet, auch wenn man sich selber wenig gefährdet fühlt. Die Massnahmen, mit denen der Bundesrat diesem Ruck nachhilft, rufen in der Presse doch nach historischer Einstufung, als «grösste Einschnitte seit dem Zweiten Weltkrieg» und ähnlich.
Wirksamer ohne «hau»
Geht er nicht gerade durchs Land oder gibt man ihn sich nicht selber, so hat der Ruck keinen guten Ruf – auch weil er so schön zum Klischee-Deutschen passt: «Nee, da sollten Sie mal bei uns draussen sehn. (…) Bei uns geht alles ruck zuck zack zack!» Die Belehrung, die das Cabaret Rotstift 1970 einem am Skilift Wartenden in den Mund legte, ist zum geflügelten Wort geworden.
Auch «hau ruck» steht heute eher unvorteilhaft für einen zackigen Vorgang, dabei war es ursprünglich ein gemeinschaftlicher, «(im Rhythmus sich wiederholender) Ruf, der gleichzeitige Bewegungen beim Heben oder Schieben einer schweren Last bewirken soll» (dwds.de). «Das Hauruck» aber kann laut Online-Duden «überstürzt und gewaltsam» sein. Als Zusammensetzungen nennen die zitierten Wörterbücher Hauruckfussball («ohne Technik und Eleganz») und Hauruckverfahren («ohne die gebotene Sorgfalt und ohne besondere Rücksichtnahme auf andere»).
In der Schweiz redet man bei solchem Vorgehen oft von einer Hauruckübung. In Deutschland und Österreich findet Google dieses Wort nicht; es ist ein Helvetismus im Hochdeutsch, nur in den einschlägigen Wörterbüchern noch nicht verzeichnet. Seinen Ursprung könnte es – eine unbelegte Vermutung – in der Milizarmee haben. Jetzt aber wirft niemand, so weit ich sehe, dem Bundesrat vor, mit einer Hauruckübung gegen das Virus anzugehen. Eher ist bei jedem Schritt zu hören, so gross hätte schon der vorangegangene ausfallen müssen. Nur hätte das womöglich keinen Ruck, sondern mehr Murren als Mitmachen ausgelöst.
— Zum Infosperber-Dossier «Sprachlupe»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Der Autor war Redaktor beim «Sprachspiegel» und zuvor beim Berner «Bund». Dort schreibt er die Kolumne «Sprachlupe», die auch auf Infosperber zu lesen ist. Er betreibt die Website Sprachlust.ch.